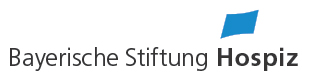Die Angehörigen müssen nicht entscheiden. Aber sie dürfen.
Im Palliativ- und Hospizzentrum am Würzburger Juliusspital rufen schon mal Menschen an, um sich einen Platz zu reservieren fürs „schöner Sterben“. Über die echten Chancen und Möglichkeiten diesseits der Lebenserhaltung um jeden Preis haben wir mit vier erfahrenen Palliativprofis gesprochen: Dr. Rainer Schäfer (Chefarzt Anästhesiologie und operative Intensivmedizin sowie Leiter der Palliativstationen), Regina Raps (pflegerische Leiterin der Palliativstationen), Elisabeth Köhler (ärztliche Leiterin des ambulanten Palliativdienstes) und Dr. Sabine Molitor (Anästhesistin und Palliativmedizinerin).
War das Sterben ein Thema, als Sie Medizin studiert haben?
Dr. Rainer Schäfer: Nein. Das Thema wurde damals im Studium völlig ausgeklammert. Ethik in der Medizin gab es nicht als Unterrichtsfach. Wir hatten studentische Initiativen; an meiner Uni hatte sich ein Arbeitskreis Ehtik gegründet. Der technische Sog war damals immens. Die Frage, die über allem schwebte war: „Was ist möglich?“ – und nicht: „Was ist sinnvoll für den Patienten?“ Die technischen Grenzen wurden immer weiter verschoben; es gab Menschen, die außerhalb der Intensivstation nicht lebensfähig gewesen wären. Die Forderung nach einer Begrenzung kam damals von außen, von den Angehörigen. Seit einigen Jahren sind Ethik und auch die Palliativmedizin endlich Pflichtfächer. Das Interesse der Studierenden ist riesengroß.
Die Frage, die früher über allem schwebte war: „Was ist möglich?“ – und nicht: „Was ist sinnvoll für den Patienten?“
Elisabeth Köhler: Während des Studiums ist mir das Defizit gar nicht aufgefallen. Das kam erst während der Arbeit. Am schlimmsten war meine Zeit auf der Intensivstation. Ich hätte mir damals gewünscht, mein Wissen von heute zu haben. Wir haben einfach alle Patienten „gerettet“.
Dr. Sabine Molitor: Ich habe in den 90er-Jahren studiert; da war schon ein Umschwung zu spüren. Die Schmerztherapie wurde zunehmend zum Thema.
Elisabeth Köhler: Heute sagen viele Patienten ausdrücklich, dass sie keine Maximaltherapie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wollen …
Was kann ich tun, wenn ich keine Maximaltherapie möchte?
Dr. Rainer Schäfer: Das Patientenverfügungsgesetz von 2009 unterstützt den Wunsch vieler Mensch, selbst entscheiden zu können, wie sie sterben wollen. 20 bis 30 Prozent unserer Patientinnen und Patienten haben eine Verfügung. Sie greift, wenn der Patient sich nicht mehr selbst äußern kann.
Bewähren sich die Verfügungen denn in der Praxis?
Dr. Rainer Schäfer: Sie können mit einer Verfügung einen Rahmen abstecken. Doch es ist für Laien nicht einfach, durchzuspielen, welche Maßnahme in welcher Situation sinnvoll ist. Deshalb empfehle ich, zusätzlich eine oder einen Bevollmächtigten zu benennen. Man sollte kritisch überlegen, wer das sein kann. Vielleicht möchte man nicht den Ehepartner mit dieser Aufgabe belasten. Vielleicht wählt man einen guten Freund. Manche Patienten benennen ihren Pfarrer oder den Hausarzt.
Der Bevollmächtigte muss übrigens keine konkreten Entscheidungen treffen. Er muss nicht entscheiden, die künstliche Ernährung einzustellen oder das Beatmungsgerät abzuschalten! Er sollte den behandelnden Ärzten erklären, was dem Patienten wichtig ist. Ob er zum Beispiel gesagt hat, dass er nicht im Zustand eines Wachkomas leben wollte. Die konkrete Entscheidung muss der Behandler aus diesen Beschreibungen ableiten.
„Die Angehörigen müssen entscheiden?“ – Diesen Satz darf man nicht bringen! Die Angehörigen müssen nicht entscheiden. Aber sie dürfen.
Dr. Sabine Molitor: Das ist ein Lernprozess bei Ärzten und Pflegekräften. Was bedeutet eine Verfügung? Für welche Situationen gilt sie? Die Patientenverfügung darf nicht die Verantwortung auf die Angehörigen abwälzen. „Die Angehörigen müssen entscheiden?“ – Diesen Satz darf man nicht bringen! Die Angehörigen müssen nicht entscheiden. Aber sie dürfen.

Elisabeth Köhler: Unsere Aufgabe ist es, Angehörige zu entlasten. Wir sind gehalten, zu fragen: „Was macht denn noch Sinn?“ Wenn sterbende Menschen zu Hause betreut werden und zum Beispiel starke Schmerzen oder Atemnot haben, rufen Angehörige oft nach dem Notarzt. Der ergreift dann in der akuten Situation Maßnahmen, die der Patient vielleicht gar nicht will. Für die Angehörigen ist es eine Erleichterung, wenn sie erleben, dass die Palliativmedizin solches Elend vermeiden kann. Dann ist nicht mehr die Frage: „Was ist lebensverlängernd möglich?“, sondern: „Was kann die Lebensqualität verbessern?“
Was erwarten Ihre Patientinnen und Patienten?
Elisabeth Köhler: Die Patienten möchten, dass Symptome wie Schmerzen, Übelkeit, Verstopfung oder Unruhe gelindert werden.
Rainer Schäfer: Sie wollen, „dass es eine Zeitlang so geht“, wie die Franken sagen.
„Noch ein paar Tage daheim, bei der Katze und der Familie, ohne Schmerzen.“
Sabine Molitor: Schwerstkranke Menschen setzen andere Maßstäbe an. Einmal ging es darum, dass einem schwerstkranken, alten Mann ein Bein amputiert werden sollte, um sein Leben zu retten. Das wollte er aber nicht. Er wollte nicht ins Krankenhaus. Er wollte noch ein paar Tage daheim leben können, bei seiner Katze und seiner Familie, ohne Schmerzen. Dabei konnten wir ihm helfen. Er ist dann daheim gestorben.
Wie kann man die Begleitung schwerstkranker Menschen zu Hause organisieren?
Elisabeth Köhler: Meist ist der Hausarzt die Schnittstelle. Hier auf dem Land haben die Familien noch engen Kontakt zu ihren Hausärzten, er kennt sie alle.
Sabine Molitor: Manche Angehörige nehmen sich einige Wochen frei. Unterstützt werden sie von Pflegediensten, bei Bedarf auch von einer 24-Stunden-Pflege und vom SAPV-Team. Und von ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleitern.
Elisabeth Köhler: Wir Ärzte kommen nur punktuell zu den Menschen nach Hause oder ins Altenheim. Wir geben im Akutfall Rat, zum Beispiel, wenn Probleme mit der Atmung auftreten.
Wer kann zu Hause begleitet werden, wer wird auf der Palliativstation aufgenommen?
Rainer Schäfer: Es kommt auf die Schwere der Symptome und die psychosoziale Situation an. Der behandelnde Arzt muss den Patienten einweisen.
Sabine Molitor: Es gibt Angehörige, die ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen: „Ich kann in diesem Zimmer nicht mehr schlafen, wenn mein Partner hier gestorben ist.“ Die schaffen das nicht.
Regina Raps: Wenn der schwerstkranke Mensch auf die Palliativstation verlegt wird, können die Angehörigen auch mal Pause machen.
Elisabeth Köhler: Die Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen würden sich gerne intensiv kümmern, aber ihnen fehlt die Zeit. Da gibt es dann die alte Dame, die klar im Kopf ist, aber ganz allein in ihrem Zimmer liegt. Im Sessel kann sie nicht mehr sitzen, das Bett kann nicht rausgeschoben werden. Sie hat keine Angehörigen, es gibt zuwenig Ehrenamtliche: Sie vereinsamt total.
Rainer Schäfer: Aber generell funktioniert die ambulante Begleitung sehr, sehr gut. Viele Hausärzte haben sich in Palliativmedizin weitergebildet und trauen sich mehr zu. Das spüren wir auch im stationären Bereich: Früher standen die Patienten mit dem Köfferchen in der Hand hier, um ihre Schmerzbehandlung einstellen zu lassen und dann nach Hause zurückzukehren. Heute kommen immer mehr Menschen erst in der allerletzten Lebensphase, weil sie bis dahin gut zu Hause oder im Heim leben konnten.
Was bedeutet das für die Palliativstationen?
Rainer Schäfer: Früher waren die Patienten im Schnitt 14 Tage bei uns. Heute sind es nur noch knapp neun Tage. 60 Prozent unserer Patienten sterben hier. Wir haben 15 Palliativbetten. Es kommt vor, dass in einer einzigen Pflegeschicht sieben Menschen sterben.
Wie kommen Pflegekräfte und Ärzte damit klar?
Rainer Schäfer: Wir geben allen Mitarbeitern – auf der Palliativstation und in der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung – die Möglichkeit, im Haus zu rotieren.
Regina Raps: Viele Palliativkräfte arbeiten in Teilzeit; das ist der Intensität unserer Arbeit geschuldet. Von 25 Kolleginnen und Kollegen arbeiten nur fünf Vollzeit. Ich bin eine von ihnen, aber ich arbeite als Stationsleiterin nicht nur in der Pflege, sondern bin viel mit Organisatorischem beschäftigt.
Man liest heute viel vom „sanften“, vom „guten“ Sterben …
Rainer Schäfer: Ja, wir haben schon einen Anruf von einer alten Dame bekommen, die sich vorsorglich anmelden wollte fürs bessere Sterben. Die Ars moriendi des Mittelalters halte ich für eine Fiktion. Das ist ganz, ganz selten. Ich habe gelernt: Wir müssen akzeptieren, dass der Sterbende das Sterben nicht akzeptiert. Die meisten Menschen hadern, vor allem, wenn sie noch Dinge zu regeln haben. Dieses „Designersterben“: das werden wir nicht schaffen.
Regina Raps: Gerade bei jungen Menschen wird das Leben ja einfach abgeschnitten. Aber auch 80-Jährige haben noch Lebenspläne.
Rainer Schäfer: Erstaunlich oft belasten schwere Konflikte die Familie. Der Sohn, mit dem man zerstritten ist, den man jahrelang nicht gesehen hat. Das wollen die Menschen vor dem Tod noch bereinigen. Das gelingt nicht immer. Aber manchmal können wir helfen. Wir hatten hier schon große Familienzusammenkünfte am Patientenbett, auch Nothochzeiten. Der Notar ist öfter hier.
Sterben gläubige Menschen leichter?
Rainer Schäfer: Sie akzeptieren es meist genauso wenig. Wir hatten Ordensleute und Pfarrer auf der Station; die haben sich genauso schwer getan.
Elisabeth Schäfer: Also bei der Vorstellung vom Fegefeuer – da hätte ich auch Angst. Ich habe mal eine Buddhistin betreut. Sie hat gesagt, sie geht ein in das große Ganze. Das fand ich eine schöne Vorstellung.
Regina Raps: Unsere Haltung ist übrigens, nicht zu bewerten. Deswegen sind die Seelsorger hier auf den Stationen sehr liberal; sie wollen unterstützen, nicht missionieren.
Verstehen Sie, wenn jemand seinem Leben selbst ein Ende setzen will?
Rainer Schäfer: Wir werden sehr selten mit direkten Sterbenswünschen konfrontiert. Wir wissen von drei Patienten, die in die Schweiz gefahren sind – in einem Zeitraum von 16 Jahren. Und wir wissen von fünf oder sechs Menschen, die den Termin wieder abgesagt haben. Meine Theorie ist: Wer es bis in die Palliativstation geschafft hat, hat den Wunsch nach Suizid nicht mehr.
Sabine Molitor: Was ich nicht verstehe: Wenn Menschen keine Palliativpflege wollen und sofort nach Sterbehilfe verlangen.
Elisabeth Köhler: Man hat viele Möglichkeiten auch diesseits des Suizids. In Würde zu gehen, das bedeutet: Ich entscheide, will ich wach sein oder sedierende Schmerzmittel nehmen! Der Patient hat diese Wahl, wir sind seine Begleiter.
Sabine Molitor: Die Vorstellungen ändern sich ja auch im Laufe einer Krankheit. Man gewöhnt sich an die allmähliche Verschlechterung und empfindet sie nicht so belastend.
Rainer Schäfer: Ja, Lebensqualität ist dynamisch. Als Angehöriger neigt man dazu, die eigenen Vorstellungen wie eine Käseglocke über den Patienten zu stülpen.
Warum arbeiten nicht alle Stationen im Krankenhaus palliativ?
Rainer Schäfer: Die intensive Begleitung ist nur nötig, wenn der Betreuungsbedarf eines Patienten sehr hoch ist. Das kann eine Normalstation nicht leisten. Deshalb entstehen in den Krankenhäusern diese kleinen „Inseln“. Sie sollen den Menschen abseits der festen – und notwendigen – Abläufe im Krankenhaus mehr Raum für Individualität geben. Aber nicht alle Sterbenden müssen auf Palliativstationen betreut werden! Bei uns sichern wir die Palliativversorgung in der gesamten Klinik durch unseren Konsiliardienst. Was wir vermeiden wollen: 1. therapeutischen Aktionismus, 2. sinnlose Routine und 3. Maßnahmen, die für den Patienten quälend sind.
Lesen Sie weiter …

Warum entscheiden sich Menschen dafür, die Begleitung Sterbender zu ihrem Beruf zu machen? Und woraus schöpfen sie ihre Motivation? Ein Gespräch mit Katarina Theissing (Foto), Pflegekraft im stationären Hospiz und Dozentin für Palliative Care und Hospizarbeit beim Christophorus Hospiz Verein in München.

Die Kunsttherapeutin Christine Kroschewski (Foto) arbeitet mit schwerstkranken und sterbenden Menschen. Manche kommen dabei ins Reden. Andere können endlich wieder tief durchatmen …